Journal für Orgel, Musica Sacra und Kirche
ISSN 2509-7601
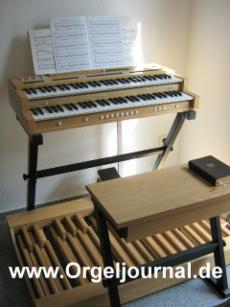 Die PC-Orgel als demokratisches Instrument
Die PC-Orgel als demokratisches Instrument
Konkretionen im Spannungsfeld eines elektronischen, digitalen, sakralen und virtuellen Simulacrums
1. Musiksoziologische Gedanken zum Instrument - 2. Ein paar technische Notizen zur PC-Orgel: Betriebsbereit nach 25-Sekunden
1. Musiksoziologische Gedanken zum Instrument
Mit den Zeilen dieser Seite werden zwei Ziele verfolgt. Einerseits soll das Instrument in konziser Form musiksoziologisch eingeordnet werden. Andererseits werden Detailinformationen zum Besten gegeben. Mit Bedacht wurde ein Foto des Midi-Blocks der Firma Hoffrichter aus dem Jahre 2006 eingefügt.
Vor allem soll jedoch der Hybris ein ehrlicher Spiegel vorgehalten
werden, die da meint, dass ein sog. virtuelles Orgelinstrument etwas
grundsätzlich Neues gegenüber der Digital- oder Sakral-Orgel darstelle.
Beide Systeme besitzen einen Computer, der eine ist intern gelagert, der
andere extern. Die mit dem sprachlogisch etwas irrlichternden Begriff
versehene sog. virtuelle Orgel arbeitet als softwarebezogene
Installation modularer und ist eher auf Updates bzw. Upgrades ausgelegt
als das hardwarebezogene Instrument Digital- oder Sakral-Orgel, das sich durch schnellste und verlässliche Ingebrauchnahme auszeichnet.
Die derzeitigen Innovationen LiVE von Johannus und Sweelinq von Noorlander versuchen, zwischen beiden Systemen kompetent eine Brücke zu schlagen. Hinzu kommt die Problematik der Abstrahlung, die hinsichtlich einer Vergemeinschaftung des Hörens für die Digital- oder Sakral-Orgel zunächst nicht so große Probleme bereitet wie die softwarebezogene Installation à la Hauptwerk oder GrandOrgue. Letztere wurde einst gar als "Egoisten-Orgel" bezeichnet.
Differenz vs. Defizit
Das jüngste historische Instrument ist das
Harmonium. Seine gesellschaftliche Relevanz darf nicht unterschätzt
werden. Es stellte eine vor
allen Dingen neue Egalité her, die insbesondere dem weiblichen Anteil
der Bevölkerung zugute kam. So muss man sich die damaligen Verhältnisse
an einem deutlichen Beispiel in Erinnerung rufen: Zu Chopins
Beerdigungsmesse mussten 1849 die Frauen in der Pariser La Madeleine
hinter einem schwarzen Vorhang singen, um Mozarts Requiem darbieten zu
können, was der Wunsch des Verstorbenen war. Im privaten Raum konnte man
sich dieser Kontrolle bereits seit Längerem durch das Klavier entziehen. Abgesehen von der
weiteren geschlechteremanzipatorischen Wirkung kam durch das Harmonium jedoch auch die
häuslich einverleibte Aura
des Sakralen und somit eine bis dahin unerlaubte Partizipation des bürgerlichen
Milieus auf den Weg.
Mittlerweile
begreifen wir, dass das Harmonium nicht nur ein mehr oder weniger
geglückter Orgelersatz für durchschlagende Zungenregister ohne
Stromkosten ist, sondern ein Instrument eigener Qualifikation darstellt.
Von dieser Erkenntnis sind viele Besitzer und Hörer digitaler Orgeln
leider weit entfernt. So sind sie häufig von einem Komplex geplagt, der sich vor der
hochkultürlichen Folie realer Kirchen- oder Konzertsaal-Orgeln mit Licht
und Schatten abzeichnet. Die bloße Differenz wird nahezu autoaggressiv
als Defizit mit Erklärungsbedarf wahrgenommen.
Mehr
noch: Selbst Poweruser leiden unter diesem Komplex, unterscheiden lustig und penibelst zwischen digital und virtuell,
rechtfertigen sich mit vorgeblich unkritisierbaren Ausstattungen und
titelillustren Gästen bei fettem Honorar auf der Orgelbank: Seht her, die einst
verfemte elektronische Plastik-Orgel ist perdú, ich habe die größte und
weltbeste Anlage, sonst kämen die erlesensten Organisten ja doch nicht zu mir
ins Wohnzimmer! Obendrein gibt es dann noch den Hersteller-Zertifizierungscode
"ultra-realistisch", mit dem man sich an der Pfeifenorgel abarbeitet, anstatt sich ehrlich zu machen und die überforderten Nahfeldmonitore
etwas tiefer zu hängen, um einmal metaphorisch konsequent zu bleiben.
Kurzum: Die Digitalorgel - egal ob mit internem oder
externem PC - kann sehr gute Ergebnisse auf den Weg bringen. Eine
reale Orgel wird sie nie
ersetzen können, da sie die komplexen Klangparameter nicht
vollumfänglich abzubilden in der Lage ist. Sie stellt eine eigenständige
Instrumentengattung dar, die für viele Menschen auch in kleineren
Einkommensverhältnissen unabhängig von ihrer Weltanschauung zugänglich
ist. Um es rhetorisch und vielleicht auch humorvoll auf den Punkt zu
bringen: Die digitale Orgel könnte eine Konkretion von Willy Brandts
einstigem Slogan "Wir wollen mehr Demokratie wagen" sein.
Lassen wir zum Schluss dieser kleinen Betrachtung den legendären Kommentar eines promovierten Konzertorganisten auf uns wirken, denn er passt sehr gut zur soziologischen Anamnese: "Was mir nämlich nicht behagt, ist das System einer von diversen Anbietern von Hardware und Software, von "Hochglanz"-Rezensenten und von finanziell überdurchschnittlich gut ausgestatteten Kunden, die allesamt gelegentlich bis zum Rang eines Gurus aufsteigen können, dominierten "geschlossenen" Hauptwerk-Gesellschaft."
 UPDATE 2. Ein paar technische Notizen zur PC-Orgel: Betriebsbereit nach 25-Sekunden
UPDATE 2. Ein paar technische Notizen zur PC-Orgel: Betriebsbereit nach 25-Sekunden
- Nach wie vor wird der dreimanualige Spieltisch
HWB2-3 der Fa. Hoffrichter aus dem Jahre 2007 verwendet. Dieser "Block"
erfuhr nun ein Upgrade: Drei neue Klaviaturen TP65LW von Fatar sind
gegen die alten TP64LW ausgetauscht werden. Sie sind ein klein wenig
rauer und dadurch griffiger. Durch die etwas kantigeren Obertasten
gewährleisten sie bei schnellem Spiel mehr Treffsicherheit. Durch die profunde Kenntnis eines süddeutschen Digitalorgel-Fachbetriebes konnten konstruktive Mängel des Blockes beseitigt werden. So wurden die Klaviaturen neu aufgehängt und stabilisiert, was ein mittiges Durchbiegen bei enthusiastischem Anschlag verhindert.
-
Ein 128-RAM-PC mit Windows 10 Pro und dem Intel Core i7-10700 (8/16x2.9-4.8 GHz), zwei
M.2-NVMe-Laufwerken 1TB und einer wiederverwendeten RME-Soundkarte (HDSP
9632
Hammerfall) – eines der letzten und zur vollsten Zufriedenheit nach
individuellen Wünschen konfigurierten Werke von Uwe Horche. Nach dem
Hochfahren des PC stehen zwei Programme zur Auswahl: Hauptwerk 6 und
Sweelinq 1.0. Auf die Aktivierung der Funktion Autostart wurde nach einigen Tests bewusst verzichtet. Sie verzögert zu sehr. Mit Sweelinq ist die Orgel nach dem Starten des PC in 25
Sekunden einsatzbereit und klangfähig. Ein alltagstauglicher Spitzenwert.
-
Links von der Orgelbank befindet sich ein 21,5''-Touchmonitor. Höhe und Winkel sind ergonomisch stimmig. 21 Zoll ist übrigens die naheliegende Mindestgröße für Hauptwerk, wenn man nur einen
Monitor besitzt. Die Registerbuttons sind bei Simple Jambs noch groß genug. Sweelinq ist in dieser Hinsicht allerdings bedienungsfreundlicher. Das zielsichere Hinlangen zu den Setzer-Buttons ist jedoch bei beiden Programmen während eines schnelleren Spiels weniger machbar.

Da sich die Pistons des Hoffrichter-Spieltisches
midimäßig nicht überschreiben lassen, wird folgender Trick angewandt: Die Setzerfunktionen Cancel/Zurück/Vorwärts werden über dis', e' und f' des Pedals (C-d' konfiguriert) bedient. Das ist ergonomisch super, weil sich
geschulte Füße die Mensur des Pedals "sehr gut merken können" und man
mit einem Autofahrer-Seitenblick die obersten Pedaltasten bestens im
Wahrnehmungsfokus hat. Alternativ werden ungenutzte Manualtasten verwendet: b''' für Zurück und c'''' für Vorwärts. Die Verwendung der Obertaste b''' ist dabei beim schnellen Zugreifen haptisch sehr sinnvoll. Noch zielsicherer sind c' und g' für + und - auf einem ungenutzten Manual. Darüber hinaus kann immer noch der
Spieltisch mit 64 Registertastern
und zwei Fußpistons für 8 x 3 Setzer für ein Best of der Samplesets
verwendet werden.
- Die neuen
Studiomonitore - aktive Nubert nuPro X-6000 RC - sind zum
Niederknien. Die andernorts vernehmlichen Foren-Unkenrufe
haben
sich als schlichte Fake News bar jeglicher Fachkenntnis erwiesen. Man muss sich mittlerweile nicht mehr
darüber wundern, dass diese linearen Lautsprecher zunehmend in
Tonstudios
eingesetzt werden. Die noch größeren nuPro X-8000 hätten allerdings angesichts des
13-Quadrat-Arbeitszimmers unverhältnismäßig gewirkt.
Zunächst
war an Podeste für die Standlautsprecher gedacht. Da die vier Membranen
erst ab einer Höhe von ca. 64 cm positioniert sind, erübrigten sich
diese nach einigen Tests. Die Winkel stimmen. Für die Hochtöner wären
Höhenabweichungen bis zu 20 Grad ohnehin völlig unproblematisch.
Als
Rear-Abstrahlung dient derzeit mit recht leiser Einstellung im
virtuellen Surround (Summen-Signal vorne und hinten der Präzision wegen)
ein
Paar der bislang verwendeten Syrincs M3-220 nebst Subwoofer. Der Kopfhörer AKG 701 kommt nicht mehr zum Einsatz.
Spätere Entscheidungen bleiben abzuwarten. Ein
zusätzlicher
nuSub
XW-900 wäre zusätzlich denkbar. Er könnte statt der 28 Hz sogar bis 21
Hz satt einbetten. Allerdings ist die Raumgröße in dieser Hinsicht nicht
unproblematisch. (mpk)
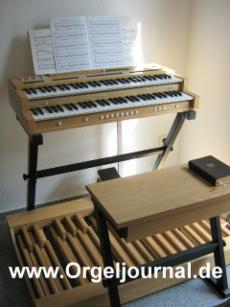 Die PC-Orgel als demokratisches Instrument
Die PC-Orgel als demokratisches InstrumentUPDATE 2. Ein paar technische Notizen zur PC-Orgel: Betriebsbereit nach 25-Sekunden
 Sweelinq 1.0 - ein Testbericht:
Sweelinq 1.0 - ein Testbericht: 